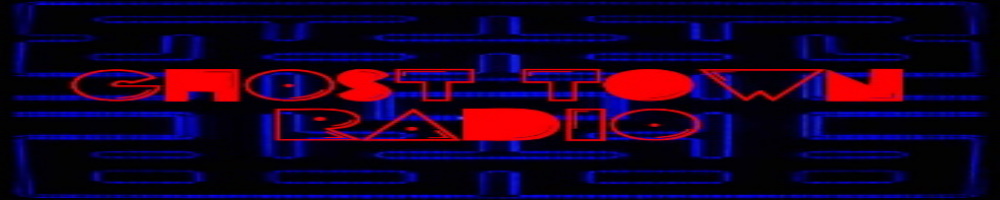Natürlich hat ein solcher Mann einen ganzen Sack voll guter Geschichten zu bieten: Denn als Curt Cress 17 war, 1969 war das, da erschien im „Musikexpress“ ein Text über ihn, der mit der Schlagzeile „Curti erinnert sich“ überschrieben war. Da war der aus dem hessischen Main-Kinzig-Kreis stammende Drummer schon einige Jahre im Geschäft, hatte mit seiner Band „Orange Peel“ Platten aufgenommen und war auf der Titelseite der französischen Tageszeitung Le Monde gelandet gewesen.

Heute, mehr als ein halbes Jahrhundert später, erinnert sich Curt Cress immer noch – weil er zwischenzeitlich zurückblicken kann, auf 12.000 Einzelaufnahmen, an denen er als Drummer beteiligt war. Und deshalb als weltweit die zuverlässigste aller Studiokräfte an seinem Instrument gilt. Eine andere unumstrittene Größe des Genres, Steve Gadd, ein guter Freund von ihm, hat’s trotz früherer Geburt und entscheidendem Standortvorteil (er ist in NYC geboren) nur auf 6.000 Beteiligungen gebracht. Dass Curt Cress die Zahl verfügbar hat, lässt wiederum tiefere Blicke auf sein Wesen zu: Denn irgendwann, an diesem Abend im Leeren Beutel, erwähnt er, dass eine Anwältin für ihn arbeitet – um dafür zu sorgen, dass all die Tantiemen auch fließen, die er für sich im Laufe seines Künstlerlebens verbuchen konnte. Und eben nicht nur schmückender Lorbeer bleiben. Wie ein Refrain zieht sich der Satz „Naja, von irgendwas muss man ja auch leben“ durch diesen Abend.

Dass Curt Cress trotzdem alles andere ist als eine kalte, geldgeile Rhythmusmaschine, ist trotzdem völlig unbestritten, sondern vor allem ein ziemlich netter Kerl, das lässt sich schön an zwei Beispielen dieses Abends belegen. Zum einen moderiert diesen Drumtalk der in Frankfurt ansässige Schlagzeug-Tuner Werner Fromm. Curt und er sind gleichaltrig und haben gemeinsam die Schulbank gedrückt. Von der letzten Reihe aus machten sie ihr Abitur. Und anschließend ein jeder eine beachtliche Karriere. Trotzdem blieben sie ein Leben lang in intensiver Verbindung. Als Curt Cress von seinem Stichwortgeber auf die gemeinsame Arbeit mit Freddie Mercury angesprochen wird, da verliert der kleine, topfit wirkende Super-Drummer, der auch als Professor an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg wirkt, kurz die Fassung. Und lässt sich backstage ein Taschentuch reichen, vom ebenfalls mitgereisten Bassisten Wolfgang Schmid. Denn die Erinnerung an den 1991 an AIDS verstorbenen Queen-Sänger, sie übermannt ihn kurz, als er davon erzählt, wie klein und zart dieser Mann gewesen sei, wenn er ihm unmittelbar gegenüberstand. Auf der Bühne aber, da habe sich Freddie Mercury als drei Meter großer Riese erwiesen.

Ebenfalls erfreulich ist die offenkundige Offenheit, das gezielt Ungeplante dieses Abends. Zwar dauert die erste Hälfte so lang, dass man, als nach rund 90 Minuten zur ersten Pause gerufen wird, eigentlich eher schon den Schlusspfiff vermutet hatte. Aber gerade das zeugt von der Ehrlichkeit, die Curt Cress verkörpert. Natürlich weiß er, wer er ist – und ist auch stolz drauf, wenn Werner Fromm beispielsweise Billy Squiers „Stroke me“ von 1982 auflegt – und er ganz lapidar kontert: „Ach ja, da war ich ja auch dabei!“ Grandios auch die Geschichten, die er von der gemeinsam Zeit mit Klaus Doldingers Passport zu erzählen weiß, wie sie gemeinsam – wir sind in der ersten Hälfte der 1970er Jahre – in Brasilien zu Gast waren, in Rio und Sao Paolo, und dort nach dreieinhalbstündiger Improvisation das Ganze kurzerhand wiederholten, weil beim ersten Gig zu viele potentielle Besucher hatten abgewiesen werden müssen. Und weil an diesem Abend eben auch Wolfgang Schmid – der Passport-Bassist jener Tage – zu Gast ist, fangen die beiden an, das Thema von „Abracadabra“ anzustimmen und dem Publikum einen Einblick zu geben, mit welchen Finessen das Rhythmus-Duo damals arbeitete.
Mit Klaus Doldinger hat Curt Cress auch Werbespots und Filmmusik eingespielt – tja, der Mensch lebt ja nicht vom Jazzrock allein! – und sagt in diesem Zusammenhang den wahrscheinlich schönsten Satz an diesem Abend: „Das Echolot bin ich auch!“ Denn bei den Aufnahmen zu „Das Boot“ („den Film mochte ich nicht so, weil ich ja den Roman vorher gelesen hatte – und ich deshalb ganz andere Bilder im Kopf hatte!“) stand Curt Cress ebenfalls zur Verfügung. Und zeigt damit auch, dass er dem technologischen Wandel, was die Erzeugung rhythmischer Muster im Pop anbelangt, immer mit großer Offenheit gegenüberstand. Weshalb er in seiner Zeit als Live-Drummer bei Spliff auch auf einem „Cressophon“ herumtrommelte. Nicht anklagend, aber fast ein bisschen ermahnend, geraten seine Worte, wenn er über seine Zusammenarbeit mit den Scorpions berichtet. Überall auf der Welt erlebe er, dass die Hardrocker aus Hannover über „Kultstatus“ verfügen, egal, ob er in Thailand in einem Tuk Tuk-Taxi mitfahre und vorne in der Windschutzscheibe die CDs der Band eingeklemmt seien – oder ob er in den Staaten unterwegs sei. Hierzulande aber ernte er oft Schulterzucken. Jenes Schulterzucken offenbar, das er auch zu häufig mit seinen eigenen Alben geerntet hat. Aber Curt Cress scheint, was diese Ambitionen anbelangt, hinweg zu sein – und spielt gerade deshalb mit Begeisterung eines seiner Solo-Alben vor, das er in London mit Beatles-Tonmeistern (der Name blieb leider unverständlich) aufgenommen hat. Und das Ausdruck dieses höchsten Ehrgeizes sei.

Im Gegenzug aber sei er ja bei vielen kommerziellen Produktionen dabei gewesen – „schließlich muss man ja auch von was leben“ – und habe mit Rick Springfield, mit Saga oder Udo Lindenberg aufgenommen. Und das ist auch eine der großen Lehren dieses Abends: Natürlich sei er auch großen Gefäßen begegnet, bei Ike und Tina Turner etwa, in denen weißes Pulver drin war. Er selbst aber habe dem Teufel stets widerstanden und sei der Verführung von Drogen nie erlegen. Weil er sonst seinen Job gar nicht habe machen können. Er würde nicht einmal eine Bühne betreten, wenn er Alkohol getrunken hätte. Stattdessen sei er viel lieber – und da ist er wieder bei seligen Passport-Zeiten – mit seinen Kollegen im Bandbus gesessen, man habe den Spiegel gelesen und mit den anderen philosophiert. Und so wird zum Finale, wenn Stephan Remmlers „Alles hat ein Ende“ erklingt, auch klar: Rock’n’Roll, das ist nicht nur das Dionysische und Rauschhafte. Nein, in der Curt Cress’schen Variante, ist kann er auch das Apollonische, das Maßvolle und Kalkulierte, das aufs menschliche Maß Reduzierte sein. Offenkundiger Beweise dafür: Mit welcher Lockerheit diese 72-jährige Schlagzeuglegende in Sneakers und Collegejacke diesen mehr als zweistündigen Abend locker wuppt. So dass das Publikum satt und zufrieden, aber eben nicht müde oder gelangweilt nach Hause gehen kann. Denn gibt es was Schöneres, als eine solche Mischung, aus live vorgetragenem Dokumentarfilm und Plattenabend unter guten Freunden?
(Peter Geiger)